Empfehlung des Monats April 2024 von Marianne Beese
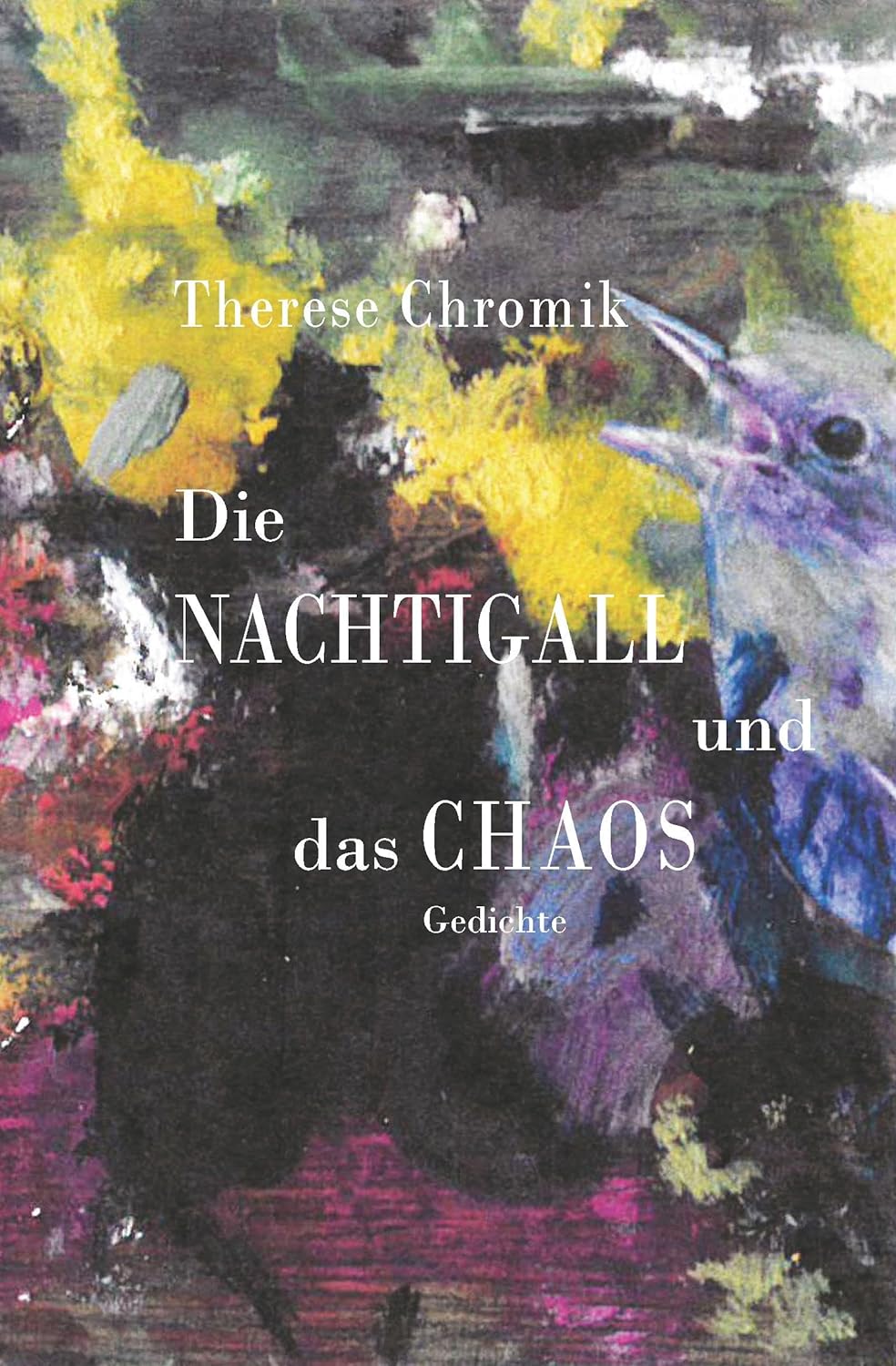
Empfehlung des Monats April 2024 von Marianne Beese:
Therese Chromik: Die Nachtigall und das Chaos
Im Spannungsfeld zwischen der Poetisierung des Alltags – und einer skeptischen Weltsicht
Bei den Gedichten des Bandes „Die Nachtigall und das Chaos“, verfasst von der Dichterin Therese Chromik, handelt es sich meist um freirhythmische, oft kurz und lakonisch daherkommende, dabei einen hohen Verallgemeinerungsgrad anstrebende Texte. Suchte man nach einem Einordnungs-Kriterium, so könnte man sie den Sinn- oder Denkgedichten (Epigrammen) zuordnen, die etwas zu benennen, gedanklich einzuordnen versuchen, doch sich auch auf Erlebtes, episodenhaft Wiederzugebendes stützen.
In einem der Gedichte wird denn auch auf Friedrich von Logau, den schlesischen Sinnspruch-Dichter, Bezug genommen, der wiederum sich in Liegnitz, der Geburtsstadt der Dichterin, aufhielt.
Fragt man nach dem Tonfall der Gedichte, so erweist sich dieser als ernst und skeptisch, ja zuweilen pessimistisch, denn es rückt unweigerlich der desolate heutige Weltzustand in den Blick; wird auf Kriege und Konflikte, Gewalt und Konfrontationen; gesellschaftliche Verwerfungen, Unrecht und Leid – und natürlich auf jenen die Topographie der Erde verändernden Klimawandel eingegangen. Vereinzelt klingt es, als sei die Hoffnung auf den Erhalt einer lebenswerten Welt geschwunden, ja als sei deren Untergang bereits vorgezeichnet.
Mit solchen Aussagen kontrastierend, vermag es das lyrische Ich jedoch, das Schöne, Lebenswerte und vor allem auch Poetische im Alltag zu entdecken, ja diesen – wie es die Frühromantiker um Novalis vorgaben – in Poesie zu verwandeln. Der poetisch und beseelt gestalteten Welt steht jedoch andernorts der Befund, dass sie dies nicht mehr sei, gegenüber. So finden Märchen-Motive und solche der Mythologie Verwendung; wird Sprichwörtliches zitiert, spielen Träume und Erinnerungs-Sequenzen eine Rolle; wird die Erlebniswelt des Kindes in ihrer Phantasie und Ernsthaftigkeit abgerufen – und kommt die Autorin in manchen ihrer Texte doch zu dem Schluss, dass der Kosmos kalt und leer sei und dass die tradierte Symbolik, etwa der Himmelskörper Mond oder Sonne, nicht mehr trage. Zugleich richtet sich ihr Blick nachdrücklich auf die Erde und das dortige Geschehen; wird das lyrische Schaffen angetrieben von einem wachen Gewissen.
Erhebt die Dichterin in solcher Weise ihre Stimme als Mahnerin und als Warnende, so spricht sich dann wieder eine starke Harmoniesehnsucht aus, und Sehnsucht nach unkomplizierter, doch intensiver Existenz; nach einer im guten Sinne ‚naiven‘ Erlebnisfähigkeit, die gleichwohl zurückzukehren scheint, wenn es in einem der Gedichte heißt: „da bin ich Kind“.
Zum Themenkreis ‚Kind‘ und ‚Kindheit‘ gehören Rückblenden in die Vergangenheit; Reminiszenzen an die frühere Heimat, die Herkunft; an die Eltern und das, was das Kind diesen verdankt. Es reihen sich hier aber auch Gedichte ein, die das lyrische ‚Ich‘ als teilnehmend an der Erfahrungswelt der eigenen Kinder, und nun der Enkel, zeigen. Entsprechend tragen viele der Texte Widmungen. Sie richten sich aber nicht nur an Kinder, sondern auch an Erwachsene aus dem Umkreis der Dichterin; etwa an befreundete Künstlerinnen. Des Weiteren wird die Korrespondenz mit Vertretern der Literatur früherer Zeiten gesucht, so mit dem Dichter Eichendorff.
Von ihrer Struktur her sind die Gedichte neben dem Sinnspruchartigen oder Gnomischen oft dialogisch aufgebaut und enthalten Refrain-gleich wiederkehrende Aussagen. Auch enden sie oft mit Fragen, wobei dies nicht durch ein Fragezeichen kenntlich wird – wie denn überhaupt die Gedichte ohne Satzzeichen auskommen.
Ein nicht zu übersehendes bzw. zu -lesendes Anliegen des lyrischen ‚Ichs‘ ist es, sich mit Sprache selbst auseinanderzusetzen; den Sinn-Gehalt von Wörtern zu prüfen und kommunikative Situationen des Alltags zu hinterfragen. Der Bedeutungsgehalt eines Wortes kann, so das Resultat, sehr widersprüchlich sein bzw. widersprüchliche Reaktionen im ‚Ich‘ hervorrufen, wie es etwa das kleine Gedicht „Mein“ belegt. Auch Missverständnisse und das sprachliche Einander-Verfehlen können eine Gesprächssituation kennzeichnen. Die Kritik an der oft gedankenlosen Verwendung von Sprache und das Hin- und Herwenden von Wörtern, die im Umlauf sind, erfolgt somit in mehreren Texten darunter „Vorwurf“ oder „Schadstofffrei“. Sprachkritik verbindet sich mit Verhaltenskritik, so in „Versuch“ und „Weichspüler“. Kennzeichnet ersteres einen indifferenten Zeitgenossen, der sich nicht äußern will, so lässt letzteres an einen Opportunisten und Schönredner denken, der die Worte „weichspült“.
In einem der früheren Gedichte des Bandes war gar von „der bösen Macht der Sprache“ die Rede, wobei einige Spielarten negativen Sprachgebrauchs benannt wurden. Der Anspruch der Autorin aber richtet sich darauf aus, Alltagssprache und Poesie miteinander zu vermitteln.
Im Kontrast zu den die Sprache reflektierenden Texten stehen Gedichte, die Atmosphärisches beschwören oder eine starke Bildlichkeit entfalten. So erscheint der Mond – welche Aussage zwischenzeitlich zurückgenommen, dann doch wieder aufgegriffen wird – in mehreren Texten als märchenhafter Sehnsuchtsort, der einen „goldenen Boden“ hat und „ein Fest [feiert]“. Das lyrische Ich staunt angesichts des Himmelskörpers, der „volltrunken“ ist. In dem Text „Anderswelt“ wird der Mond mit Geborgenheit, Wärme und Versöhnung assoziiert. Dieser Bedeutungs-Bogen wird auch hin zum letzten Gedicht des Bandes („Mondwissen“) gespannt.
Geschieht in den Mond-Gedichten eine Personifizierung bzw. Symbolisierung, so auch andernorts, etwa in dem titelgebenden Gedicht „Die Nachtigall und das Chaos“, das in zwei Fassungen existiert. Im ersten der beiden Texte ist bekräftigt, dass die Nachtigall symbolisch für Dichtung bzw. Gesang steht, aber auch für (verlorene) Liebe. Für die Dichterin ist sie darüber hinaus mit ‚Trost‘ verbunden. Im zweiten Text hat der Gesang der Nachtigall die Macht, die Dinge zu ordnen. Auch dem lyrischen Ich bietet sich die Dichtung als Mittel an, das Chaos als gegenwirkende Kraft, doch zugleich als Stoff, aus dem geschöpft wird, gestaltend zu überwinden.
In einer Reihe von weiteren Gedichten werden Tiere – vor allem Vögel – der Menschenwelt angenähert. So sind in dem Text „Von Tauben und Möwen“ die Vertreter der jeweiligen Vogelart lautmalerisch charakterisiert und es wird ihr Dialog so erlebt, als wechselten sie „die immer gleichen Parolen“.
In anderen Gedichten, in denen sich der Blick auf Vögel richtet, wird ebenfalls ihre Kommunikationsfähigkeit betont oder wird das Attribut des Fliegen-Könnens hervorgehoben. Diese Eigenschaft, die ja auch Insekten besitzen, erscheint dem ‚Ich‘ als erstrebenswert, und so vollzieht es, etwa in dem Gedicht „Libelle“, die Metamorphose in jenes Lebewesen zwar in der Möglichkeitsform, doch auf selbstverständliche Weise, als hätte es „nie / etwas anderes getan“.
Die besagte Fortbewegungsart, die an ‚Leichtigkeit‘ und ‚Überschau‘ denken lässt, spielt (so im Text „Höhenflug“, wo sie mit einem Flugzeug gedanklich gekoppelt ist) aber auch eine Rolle in der Bedeutungsvariante ‚hochfliegender‘ menschlicher Wünsche, denen kein Ankommen in der Wirklichkeit gelingt.
Um die Interaktion von Mensch und Tier geht es wieder andernorts, so in „Der Pfau“, wo das lyrische Ich mit jenem Vogel in Beziehung tritt, der seit jeher als etwas Besonderes gilt und auch gegenwärtig eine Pracht besitzt, die er, Rad-schlagend, schließlich entfaltet.
Die Natur in Gestalt des Waldes mit seinem pflanzlichen Zubehör, dem Kleingetier – doch auch mit märchenhaften Wesen wie Baumnymphen, Feen und Elfen erscheint versinnbildlicht in den Gedichten „Bei den Dryaden“ und „Nach dem Sturm“. In seiner Ganzheitlichkeit kommuniziert dieser Naturkosmos untereinander und spricht mit vielfachen Stimmen zur Dichterin. Um aufgebrachte Natur, die sich als erzürnte Gottheit kundgibt, geht es in dem Gedicht „Sturm“, das in seiner Reimform an ein Kinderlied denken lässt.
Von „Spiegelungen“, die sich in der natürlichen Umwelt, aber auch zwischen Kosmos und Erde und dem Menschen ergeben, handelt das Gedicht gleichen Titels, während ein Zug ins Märchenhafte, der mit Verwandlung einhergeht, den Text „Wo ich wohne I“ prägt. Das ‚Ich‘ wird hier zum Zubehör der Elemente, sprich: der Wolken, und gewinnt aufs Selbstverständlichste deren Eigenschaft, Regen zu spenden.
Heißt es zum Abschluss: „fast hätte ich mich aufgelöst“, so geschieht solch ein Vorgang der Auflösung dann doch, und zwar in dem Gedicht „Schnee“. Hier wird die Zeit zwischen „Augenblick“ und „Ewigkeit“ sowie die räumliche Spanne zwischen der Anwesenheit des Ichs, das spricht, im Haus – und seinem Hinausgezogen-Werden in „Weiten“ durchmessen, ehe es in einem vorgestaltlichen Raum zu „Nebelstaub“ wird.
Weitere Gedichte verbleiben im Umkreis von Kunst und Poesie; fragen deren Stellenwert im Leben nach oder versuchen, das Geheimnis der Inspiration; der Gedicht-Entstehung, zu ergründen. Auch gibt es immer wieder Texte des Sich-Erinnerns, in denen ebenfalls Poesie und Dichtertum eine Rolle spielen. So wird nicht ohne Wehmut ein Rückblick auf einen früheren Aufenthalt in Sankt Petersburg getan und nochmals eine Szene am Ufer der Newa nacherlebt, „wo die Mücken zu Brodskys Versen tanz[t]en“; auch Gesang und Gitarrenklänge vernehmbar wurden und wo Menschen, die einander fremd waren, doch über Sprachgrenzen hinweg zueinander fanden.
Die Fragilität des heutigen Standorts „auf dem Bahnhof / der Gegenwart“ “, der zugleich ein solcher zwischen Zukunft und Vergangenheit ist und der das weitere Richtung-Nehmen offenlässt, bezeichnet das philosophisch getönte Gedicht „Fragen“.
Der Text „Im Garten der Künstlerin“ präsentiert dagegen eine märchenhaft-mythologisch verfremdete Welt, in der die Geschöpfe lebendig werden, da ihnen künstlerischer Atem eingehaucht wurde. Auch das Gedicht „Haus“ gehört zu den lyrischen Texten, die von der verlebendigenden Macht der Kunst, hier: der Poesie, sprechen und dieser den Raum des Inneren bzw. Innerlichen zuweisen.
Sagen einige Texte etwas über den Vorgang der Gedicht-Entstehung aus, so erscheint die als Resultat eines intensiven Wechselspiels zwischen Außen- und Innenwelt. Es verbinden sich in „Amsel II“ charakteristischerweise Schatten-werfende Blätter eines Baumes und das weiße Schreib-Blatt, dem die Dichterin ihre Gedanken anvertrauen wird, miteinander.
Von der Tatsache, dass Traum, Phantasie und wiederum Poesie dem ‚Ich‘ vorübergehend Zugang zu einer Sphäre der Schwerelosigkeit, ja gefühlten Unsterblichkeit verschaffen, handelt das Gedicht „Amor und Psyche“. Mythische Gestalten stehen hier wieder für vor-bewusste innerseelische Kräfte.
Um die Dialektik von Leichtigkeit und Schwere, wobei letztere zugleich Wort-Armut bedeutet, geht es auch in dem Text „Dialog“, in welchem als Zeichen einer wiedereinsetzenden Inspiration ein „Fallschirmwort“ aufschwebt. In anderen Texten werden Möglichkeiten oder Anlässe, die zur Gedichtentstehung beitragen können, lyrisch benannt. In einem Falle („Conjunctivus irrealis“), ist es die nicht genutzte Chance zweier Menschen, einander wieder zu begegnen, aus der ein Gedicht hervorgeht.
Von einer sehr wohl wahrgenommenen Möglichkeit, nämlich der, Anschluss an Gleichgesinnte zu finden, handelt „Erste Begegnung in der Dichterrunde“. Ein exotisch anmutendes Dichter-Refugium erwartet die Ankommende, und wenn es, dies näher bezeichnend, heißt: „Die Muse schwebt in sanftem Blau / im Zauber neuer Worte / seh ich auf einer Wolke den / der mir die Tür geöffnet hat“, so mag hier anklingen, dass Dichtung sich in ‚luftige Höhen‘ erheben kann.
Im Themenkreis ‚Poesie‘ verbleibt auch das Gedicht „Windharfe“. Es lässt jenes tradierte Motiv bzw. alte Instrument entgegen landläufiger Erwartung nicht zum Synonym für Wohlklang und Harmonie werden, sondern bringt es in Zusammenhang mit einem starken Wind, der „an der Hausecke entlang“ „schrammt“ und entsprechend als Missklang auf das Ohr des lauschenden ‚Ichs‘ trifft.
In dem Text „Beim Betrachten eines Baumes“ werden Analogien hinsichtlich der Vorgänge/Geschehnisse in der Natur und in der Menschenwelt gezogen; wird sinnspruchartig und im dialektischen Hin- und Herwenden der Begriffe und Bilder das Wechselspiel beider Welten, unter Einbeziehung des Mythos, dargestellt. Letztlich entsteht dann eine Sinnlinie hin zum lyrischen Schaffen; zur Kreativität.
Das nicht nachlassende Interesse an Himmelskörpern, auch als poetisches ‚Material‘, zeigt sich in einer Reihe weiterer Gedichte. In „Venus“ wird Anekdotenhaftes bzw. geschichtlich Überliefertes mit einem Märchenmotiv verknüpft und so zu einem poetischen Gebilde rund um den Planeten Venus verdichtet.
Auch in „Zweifel I“ richtet sich der Blick in den Himmel; auf Sternbilder, und es ist zunächst ausgesagt, dass sich astronomisches Geschehen unabhängig vom Menschen vollziehe. Auch das lyrische Ich weiß um seine Bedeutungslosigkeit angesichts interstellar-kosmischer Prozesse. In dem Text „Blick in den Sternenhimmel“, in dem wieder ein sinnspruchartiges, gnomisches Sprechen erfolgt, wird hierzu jedoch ein Kontrapunkt gesetzt; ist vom Himmel als dem „Ort eines / Schöpfers und Lenkers über uns“ die Rede und heißt es in der letzten Strophe: „Wie groß muss unser Vertrauen sein / dass wir die Erde und uns darauf / für die Auserwählten im All halten / zwischen all den Sternen / und der Unheimlichkeit des Alls“.
In „Zweifel II“ klingt wieder Skepsis an angesichts dessen, dass der Himmel mit religiösen Gehalten gefüllt bzw. mit ‚Gott‘ gleichgesetzt wird.
Von ‚Erdung‘ und Verankerung am Boden – und einhergehend vom Behütung-Suchen in einer verunsichernden Gegenwarts-Situation handelt der Text „Mein Zelt und zwei Heringe“. In „Welterfahrung“ tut sich wieder die ‚Schere‘ auf zwischen einer tradierten idealen Weltinterpretation und dem durch Zerstörungen geprägten Realzustand. Um zerstörte Natur geht es auch in dem Gedicht „Garten der Erde“, das in charakteristische Allianz Mythos und Alltagssituation verbindet und dabei von der Erfahrung spricht, Zeugin jener Zerstörung geworden zu sein, wenngleich es sich ‚nur‘ um das Fällen eines Baumes handelte.
Lassen sich die beiden letzteren Gedichte unter das Thema ‚Die Dichterin als Kritikerin der Gegenwart‘ subsumieren, so greift sie andernorts wieder auf den Fundus ihres bisher gelebten Lebens zurück. Die Erinnerung an ihre Kindheit, an „Heimat“, verbindet sie assoziativ mit weiten, winddurchzogenen Landschaften, Kornfeldern; mit Gegenden, die von Sagen-Gestalten wie den „Kornmuhmen“ bevölkert waren; ebenso mit dem Gefühl von Geborgenheit. Auch die früheren Texte „Heidekind“ und „Vermächtnis“ reihen sich ein in jene Art von Gedichten, die den erinnernden Weg zurück in die Kindheit suchen, teils der Rätselhaftigkeit von Traum-Botschaften nachsinnen und in denen besonders die Gestalt der Mutter hervortritt. Auch vom Gegenwartsstandort aus bekennt das lyrische Ich: „nahe bin ich ihr“ und bekräftigt dies in dem Text „Phänomen Mutter“. Dem Vater verdankt das ‚Ich‘ offenbar das astronomische Interesse, wie das Gedicht „Der hellste Stern“ zu denken nahelegt.
In „Liegnitzer Lebensbaum“ ist das Thema die Identitätssuche des damaligen Kindes – und es wird der noch immer gültige Bezug, den der „Mädchenhaarbaum“ zum schreibenden ‚Ich‘ hat, hergestellt. Es ist der, „Symbol für Hoffnung und / langes Leben / mein Lebensbaum“ zu sein. Dem Wunsch nach einem langen Leben kontrastiert jedoch die Einsicht, dass eine Existenz auf Erden rasch durchmessen sei.
In einer Reihe von Texten erfolgt die Bündelung von Themen, die sich auf die unmittelbare Gegenwart beziehen und den Weltzustand als einen höchst bedrohlichen konstatieren. So erfolgt die pessimistische Feststellung, dass eine Spirale von Gewalt dadurch entstehe, dass der Mensch von der Gewalt als Mittel zur Durchsetzung seiner Ziele nicht lassen könne. In einem anderen Gedicht („Wir wissen“) wird die Behauptung, dass es keinen Krieg mehr gäbe, anhand der Berichterstattung in einer Zeitung ad absurdum geführt.
Inmitten der Gegebenheiten versucht das ‚Ich‘ sich zu verorten; berichtet vom „Auf und Ab“ seiner Gefühle; von der „Trauer um dieses Leben“ und der Lebens-Liebe und davon, „wie es sich anfühlt / als Mensch unter Menschen zu leben“; auch angesichts des in den Blick genommenen Lebens-Endes, „ehe du über den Tränenfluss hinübersetzt / in eine andere Welt“.
Eine gleichsam hellere Tonlage weist das Gedicht „Abgesang auf das Sofa“ auf; hier erscheint die Bilanz, die gezogen wird, als eine Zwischenbilanz, denn mit dem Verlust des alten Sofas schließt sich nicht der Lebenskreis seiner Besitzerin, sondern es wartet vielmehr ein neues Sofa darauf, mit wieder anderen Situationen des Alltäglichen oder Besonderen verknüpft zu werden. Ein Faktum, welches das ‚Ich‘ des Gedichts hier wie in anderen Texten freilich ausspricht, ist das des Alt-geworden-Seins.
Desto mehr versucht es, sich der Nachkommen; der Familie zu versichern und an der lebendigen Betrachtungs- und Erlebnisweise der Kinder teilzuhaben. Hier finden nun etliche Widmungstexte ihren Platz, so „Das Kind am Klavier“, „Frage des Kindes“, „Erste Erfahrungen mit der Sonne“ oder „Dialog mit Tammo“. Auch in „Erziehungsversuch“ wird die Welt mit den Augen eines Kindes gesehen, wobei sich erweist, dass die kindliche Sicht nicht mit jener der Erwachsenen übereinstimmt.
Das Motiv vom Kind-Sein im Sinne der Sehnsucht nach einfachem, doch intensivem Erleben und nach Unterwegssein; Ankommen und wieder Aufbrechen als Synonyme für Lebendigkeit, bezieht die Dichterin, wie anklang, schließlich auch auf sich selbst. Sie siedelt diese Existenzweise, das Kontrastprinzip verwendend, in einem Zwischenbereich an; benennt in dem Text „Zwischen Schobüll und Kiel“ „Lautes und Leises“, „Schweres und Leichtes“, bewegt sich zwischen „Träumen und Wachen“, wohl den Ausgleich; auch den des „Frieden-Machens“, suchend. Vom Bemühen um Harmonie und Wohlklang kündet auch das Reimschema.
„Wie die Brieflesende“ ist ein Gedicht, das die Simultaneität der Gegebenheiten rund um zwei Liebende; einen Schreibenden und eine Lesende, benennt. Diese werden vom gleichen Licht „erhellt“. Die Erinnerung an eine einst gelebte Liebe und Trauer über den Verlust des geliebten Menschen verbinden sich in mehreren Gedichten miteinander, so in „Wund“ oder „Die Welle“. Es erweist sich, dass sich Erinnern und Trauern gewandelt haben, aber nicht verloren gegangen sind. Motivisch schließen sich hier Gedichte, die von der Einsamkeit des ‚Ichs‘ handeln, an. Diese wird auch oder gerade in Situationen des überreichlichen Kontakt-Findens oder der Erfolge erfahren.
Neben Gedichte, die auf Verluste zurückkommen, treten auch solche, die von einem Gefühl des Sich-bedroht-Fühlens oder von Angst handeln. Letztere macht sich etwa in immer wiederkehrenden Träumen geltend, in denen das lyrische Ich eine frühere Situation nochmals durchlebt. Konkret handelt es sich dabei um eine traumatisch nachwirkende Episode während der Flucht im Gefolge des Krieges.
Um Rückblicke auf Historisches, das sich wiederum mit der Familiengeschichte verbindet, geht es in weiteren Texten. Zunächst klingt in diesem Kontext die Thematik ‚Krieg‘ und dessen Folgen allgemein an, wird gekleidet in die Metapher des vergeblich an einer Hauswand hochrankenden Efeus, dessen Bestreben, eine schwarze Stelle, die ehemals der Tarnung diente, zu überwachsen, scheitert. Zeigen sich Spuren der Vergangenheit hier untilgbar, so wird in weiteren Texten der ‚Erfahrungsvorsprung‘ der Eltern- und Großeltern-Generation, welche Krieg, Hunger, Elend und Seuchen erlebten, thematisiert und nach der Bereitschaft der Heutigen gefragt, aus diesen Erfahrungen zu lernen.
Konkret Familiengeschichtliches wird gleichsam im Zeitraffer abgerufen in dem Gedicht „Der Krieg schlief nicht in Kiew“. Die pointierende Bilanz aus überlieferter Kriegs- und Todeserfahrung lautet: „Niemand hat überlebt // Ich dachte überlebt hätten sich / alte Geschichten / und Kriege“.
Weitere Gedichte widmen sich lakonisch und doch insistierend der Frage: „wie macht man Frieden“; so der Text „Derzeitige Diagnose“, der sich aus der Lektüre aktueller Nachrichten herleitet. Vergleichbar ist „Gesetzt den Fall dass“ eine poetische Reflexion, die an die Berichterstattung in den Medien anknüpft. Die Bedrohungslage in der Welt wird in der Möglichkeitsform diverser Szenarien durchgespielt und es wird auf die Gefahr einer Abschreckungspolitik, die sich des Mittels der ‚verbalen Aufrüstung‘ bedient, verwiesen.
Eine Reihe von Texten benennt die Kürze und Kostbarkeit menschlichen Lebens und dessen Vergänglichkeit im Zusammenhang damit, dass ‚Heutige‘ Verantwortung für nachfolgende Generationen tragen. Folgerichtig beziehen sich mehrere Gedichte auf das Thema „Klimaveränderung“. Der Text, der diesen Titel trägt, zeichnet die ‚Momentaufnahme‘ einer bereits veränderten Welt; das gegenüber früheren Zeiten beängstigend abweichende Geschehen, das etwa pflanzliche Organismen oder Tiere betrifft; das verstärkte Hervortreten von Naturphänomenen wie Wirbelstürmen oder Hochwasser – und die gewandelte Topographie von Landschaften. Diese haben zugleich ihren Zauber verloren, beherbergen nun auch keine übersinnlichen Wesen mehr; sind nicht länger Heimstätte für Märchen und Sagen.
Im Kontrast zu diesem Befund verlangen die vor sich gehenden Veränderungen in der Welt, die auch die gewohnten Vorgänge dort zu zerstören drohen, nach der Vergewisserung, dass zumindest im heimischen Umfeld noch alles ist, wie es ist – so spricht es das Gedicht „Gewissheiten an der Nordsee“ aus.
Die Infragestellung einer Beseeltheit der Natur und des Weltalls bzw. den ausbleibenden Glauben daran sprechen wieder andere Gedichte aus, so „Stadtlicht statt Nacht“, wo es heißt: „Mond und Sterne zuweilen noch / Metaphern im Gedicht / aber man glaubt ihnen / nicht mehr“. Vergleichbares beinhaltet der Text „Der neue Himmel“, der ein entseeltes Weltall zeigt – doch zu der Schlussfolgerung gelangt: „… wir ahnen nur / der Himmel ist / in uns“
Klingt dies nachgerade hoffnungsvoll, so werden auch anderweitig, vor allem in der Natur, ermutigende ‚Zeichen‘ wahrgenommen. Am Beispiel einer abgestorbenen Buche wird erläutert, dass etwa pflanzliche Organismen „über den Tod hinaus“ Nützliches bewirken können und dass die Natur gleichsam für ihre Regeneration sorgt. Es wird auf hilfreiches, einander unterstützendes Verhalten in der Pflanzen- und auch der Tierwelt verwiesen. So entstehe bei Bäumen ein „unsichtbares Wurzelliebeswerk“.
Der Mensch wiederum, so halten es die beiden Gedichte „Naturidentisch“ und „Der Traum im Topf“ fest, wende sich der Natur etwa in Gestalt der heimischen Zimmerpflanzen zu und pflege diese sorgsam, was als eine Art Ersatzhandlung erscheint angesichts des global vielfach unterbleibenden Naturschutzes bzw. der Naturzerstörung, so des Regenwaldes.
Die Naturnähe der Dichterin aber bleibt glaubhaft, zumal es eine ganz konkrete Verbundenheit mit dieser ist, wie etwa das Gedicht „Wo ich wohne II“ ausspricht.
Die naturnahe Umgebung wird auch immer wieder zum Inspirationsquell; lässt etwa das sehr poetische Gedicht „Borke und Rosenblatt“ entstehen, in dem die Pflanzenwelt gleichnishaft über sich hinausweist. Auch in dem Gedicht „Pusteblume“ werden naturhafte Vorgänge in den Bereich der Sprache übertragen, sendet doch die Pusteblume „ihre Wortschirme aus“.
Der Band endet, indem er Bedrohung – auch des eigenen Hauses durch ein im benachbarten Wald wütendes Feuer – und das Motiv der Vertreibung aus dem Paradies unter heutigen Vorzeichen – neben die Vision einer versöhnten Welt, die nun wieder auf den Himmelskörper Mond projiziert wird, stellt.
Als Resümee: Die vielfältige und dabei höchst widersprüchliche Sicht auf heutige Gegebenheiten; das Changieren zwischen Harmoniesehnsucht, poetischem Empfinden sowie Nüchternheit und Skepsis – und letztlich auch das Schöpfen aus dem Erfahrungsschatz des bisher gelebten Lebens lassen den Band zu einer authentischen und bereichernden Lektüre werden, die potenziellen Leserinnen und Lesern nachdrücklich empfohlen sei.
Therese Chromik:
Die Nachtigall und das Chaos
Leinen mit SU,128 S., 20,00 €
ISBN 978-3-948682
Verlag Ralf Liebe, Weilerswist 2023

